|
NASA entdeckt "Cousin" der Erde
von Stefan Deiters
astronews.com
24. Juli 2015
Bei weit über tausend entdeckten extrasolaren Planeten
müssen sich Astronomen schon etwas Besonderes einfallen lassen, um es mit einer
weiteren Entdeckung auf die Titelseiten der Zeitungen zu schaffen. Ein sehr
erdähnlicher Planet wäre so eine Besonderheit. Deswegen bezeichnet die NASA die
Neuentdeckung Kepler-452b auch als "Cousin" der Erde. Wirklich erdähnlich
dürfte er wohl eher nicht sein.
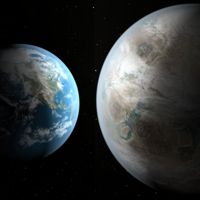
Der neu entdeckte Planet Kepler-452b (rechts)
im Vergleich zur Erde. Wie der Planet wirklich
aussieht, wissen die Astronomen allerdings nicht.
Sie kennen lediglich seinen Durchmesser.
Bild: NASA / Ames / JPL-Caltech [Großansicht] |
Astronomen, die mit den Daten des NASA-Weltraumteleskops Kepler
arbeiten, haben gestern die Entdeckung eines
weiteren Planeten bekannt gegeben, der in der sogenannten habitablen Zone um einen
sonnenähnlichen Zentralstern kreist - also in einem Abstand von seiner Sonne, in
dem die Strahlung gerade so groß ist, dass Wasser auf der Oberfläche in seiner
flüssigen Form existieren könnte. Für das Team ist dieser Fund - zusammen mit
der Entdeckung weiterer potentieller Planeten - ein wichtiger Schritt auf
dem Weg zum Aufspüren einer zweiten Erde - also eines Planeten, der unserer
Heimatwelt in praktisch allen aus der Entfernung beobachtbaren Aspekten gleicht.
Allerdings ist auch Kepler-452b, der gestern die Schlagzeilen bestimmte, keine solche "zweite Erde", wird von dem Team aber als
kleinster bislang entdeckter Planet in der habitablen Zone eines sonnenähnlichen Sterns
beschrieben.
"Am 20. Jahrestag der Entdeckung, die gezeigt hat, dass es auch Planeten um
andere Sonnen gibt, hat Kepler einen Stern mit Planet entdeckt, der
Sonne und Erde sehr ähnlich ist", so der für Wissenschaft zuständige
Administrator der NASA John Grunsfeld. "Dieses faszinierende Ergebnis bringt
uns der
Entdeckung der Erde 2.0 einen Schritt näher." 1995 wurde mit 51 Pegasi der
erste extrasolare Planet entdeckt, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist.
Wirklich ähnlich allerdings dürften sich Kepler-452b und die Erde nicht sein:
Der Durchmesser der fernen Welt ist 60 Prozent größer als der unserer
Heimatwelt, was ihn zu einer "Supererde" macht. Da man die Masse und
Zusammensetzung des Planeten nicht kennt, kann man über sein Aussehen nur
spekulieren - es könnte sich aber um einen Gesteinsplaneten handeln. Für einen Orbit um seine Sonne benötigt Kepler-452b 385 Tage, der Stern
selbst ist rund sechs Milliarden Jahre alt und damit 1,5 Milliarden Jahre älter
als die Sonne.
"Wir können uns Kepler-452b wie einen älteren und größeren Cousin der Erde
vorstellen", so Jon Jenkins vom Ames Research Center der NASA. "Es ist
faszinierend, dass sich dieser Planet sechs Milliarden Jahre lang in der habitablen
Zone seines Sterns aufgehalten hat und damit länger als die Erde. Das wäre schon
eine sehr gute Gelegenheit für die Entstehung von Leben, wenn die notwendigen
Zutaten dafür vorhanden sind."
Zur Bestätigung des Planeten, der in den Daten des Weltraumteleskops Kepler
aufgespürt wurde, führten die Astronomen zusätzliche Beobachtungen mit
verschiedenen erdgebundenen Teleskopen durch. Diese lieferten auch neue Daten
über die Größe und Helligkeit des Zentralsterns von Kepler-452b. Der Planet
befindet sich in einer Entfernung von 1.400 Lichtjahren im Sternbild Schwan.
Die gestern auch vorgestellten Planetenkandidaten im Kepler-Material erhöhen
die Zahl der potentiellen Planeten in den Daten
um weitere 521. Diese Kandidaten erfordern noch eine gründliche Nachbeobachtung,
um schließlich zu bestätigen, dass es sich bei ihnen wirklich um Planeten
handelt. Auch unter diesen neuen Planetenkandidaten befinden sich Welten, die nur wenig
größer sind als die Erde. Zwölf der neuen Kandidaten umkreisen ihre Sonne zudem in
der habitablen Zone.
Mit dem Weltraumteleskop Kepler wird mithilfe der sogenannten
Transitmethode nach Planeten gesucht: Dazu überwacht Kepler die
Helligkeit zahlreicher Sterne in einem kleinen Himmelsbereich. Wandert - aus
Keplers Perspektive - ein Planet vor seinem Stern vorüber, verdunkelt
dieser seine Sonne. Kepler registriert dadurch einen geringfügigen
Helligkeitsabfall. Ein regelmäßiger Helligkeitsabfall - entsprechend der
Umlaufperiode des Planeten - könnte also ein Hinweis auf einen Planeten sein.
Doch für leichte Schwankungen der Helligkeit eines Sterns kommen auch
noch verschiedene andere Gründe infrage, weswegen jeder potentielle Planet, der
mit Keplers Hilfe aufgespürt wird, durch sorgfältige und oft auch
langwierige Nachbeobachtungen bestätigt werden muss.
|

