|
Neuer Beobachtungslauf beginnt
Redaktion
/ Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik (AEI)
astronews.com
1. Dezember 2016
Die LIGO-Detektoren in den USA, mit denen im vergangenen
Jahr erstmals Gravitationswellen direkt nachgewiesen werden konnten, haben mit
ihrem zweiten Beobachtungslauf begonnen. Wegen der erhöhten Empfindlichkeit
erwarten die beteiligten Wissenschaftler noch deutlich mehr verdächtige Signale.
Im kommenden Jahr wird zudem auch ein italienischer Detektor mit Messungen
beginnen.
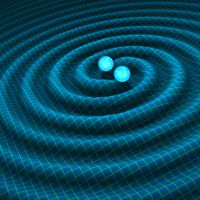
Gravitationswellen, die von zwei einander
umkreisenden Neutronensternen erzeugt werden.
Bild: R. Hurt/Caltech-JPL [Großansicht]
|
Gestern starteten die Gravitationswellen-Detektoren Advanced LIGO (aLIGO)
in den USA und GEO600 in der Nähe von Hannover offiziell ihren zweiten
Beobachtungslauf "O2". Die Empfindlichkeit von aLIGO ist dabei besser
als bei der ersten Beobachtungskampagne (O1), bei der Gravitationswellen von
zwei Paaren kollidierender Schwarzer Löcher beobachtet wurden.
Die Forschenden der LIGO Scientific Collaboration am
Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut, AEI) in
Hannover und Potsdam haben die Datenanalysewerkzeuge, die Modellierung der
Quellen und die Detektortechnologie weiter verbessert. Sie sind maßgebliche
Partner in der internationalen Kollaboration und erwarten, dass weitere Signale
in O2 nachgewiesen werden.
"Wir haben die vergangenen Monate genutzt, um uns auf den nächsten aLIGO-Beobachtungslauf
sehr gut vorzubereiten. Wir haben unsere Wellenformmodelle verbessert, unsere
Suchmethoden beschleunigt, unsere Rechenleistung erhöht und unseren eigenen
Gravitationswellendetektor empfindlicher gemacht. Mit anderen Worten: Wir sind
bereit dafür, uns wieder von der Natur überraschen zu lassen", sagen Bruce
Allen, Alessandra Buonnano und Karsten Danzmann, die dem AEI in Hannover und
Potsdam vorstehen.
Die aLIGO-Detektoren haben mit der Datenaufnahme im O2-Lauf begonnen, nachdem in
den letzten Wochen experimentelle Probeläufe durchgeführt wurden. Diese dienten
der Feinabstimmung der Messinstrumente und der Datenerfassungsprozesse. aLIGO
ist nun empfindlicher als je zuvor: die Detektoren sind in der Lage, Signale aus
einer 20 Prozent größeren Entfernung zu detektieren als im letzten O1–Lauf,
welches zu einer etwa 75 Prozent größeren Detektionsrate führen sollte. O2
dauert insgesamt sechs Monate (bis Mai 2017) und könnte zur Entdeckung von bis
zu einem halben Dutzend Signalen von Verschmelzungen binärer Schwarzer Löcher
sowie anderer Gravitationswellensignale führen. Der italienisch-französische
Detektor Advanced Virgo soll in der zweiten Hälfte von O2 ebenfalls
Daten aufnehmen.
Der GEO600-Gravitationswellendetektor bei Hannover wird zusammen mit den
Advanced LIGO-Detektoren und (in der zweiten Hälfte von O2) mit
Advanced Virgo an O2 teilnehmen. Viele wichtige Detektortechnologien wurden
bei GEO600 entwickelt und getestet, die nun in beiden LIGO-Geräten zum Einsatz
kommen und ihre bisher unerreichte Empfindlichkeit ermöglichen.
Dazu gehören Hochleistungslasersysteme und die monolithischen
Spiegelaufhängungen zur seismischen Isolierung. Das britisch-deutsche Experiment
GEO600 ist derzeit der einzige Detektor weltweit, der kontinuierlich beobachtet
und dabei nicht-klassisches (gequetschtes) Licht einsetzt, um seine
Empfindlichkeit am oberen Ende des Frequenzspektrums von Gravitationswellen
weiter zu verbessern.
In den nächsten Monaten ist eine der Hauptaufgaben bei GEO600 die
Weiterentwicklung von Verfahren zur Erzeugung und Handhabung von gequetschtem
Licht für zukünftige Detektorgenerationen, insbesondere durch die Verringerung
der optischen Verluste.
Am AEI Hannover wird ein großes Team unterschiedlicher Datenanalysten nach
verschiedenen Gravitationswellensignalen suchen: Bereits während der
Datenaufnahme sucht man in Echtzeit nach Verschmelzungen von Schwarzen Löchern
oder Neutronensternen sowie nach Gravitationswellenausbrüchen, wie sie etwa bei
Supernova-Explosionen vorkommen. An diese Echtzeit-Suchen schließen sich
komplexere und tiefergehende Analysen an.
Die Untersuchungen werden auf "Atlas" am AEI in Hannover durchgeführt, dem
weltweit größten Supercomputer für die Gravitationswellen-Datenanalyse. Atlas
stellt mehr als 40 Prozent der gesamten Rechenleistung für die LIGO
Scientific Collaboration bereit. Vor kurzem wurde Atlas um zehntausend neue
CPU-Kerne erweitert, was seine Rechenleistung etwa verdoppelt. Andere
AEI-Forscher betreiben das verteilte Rechenprojekt Einstein@Home, das nach
Gravitationswellen schnell rotierender Neutronensterne sucht. Einstein@Home wird
die O2-Daten bald nach Ende des Beobachtungslaufs analysieren.
Vor O2 haben Forschende am AEI in Potsdam die Fähigkeiten der aLIGO-Detektoren
verbessert, Parameter der Gravitationswellenquellen zu beobachten und
abzuschätzen. Für die Suche nach Verschmelzungen binärer Schwarzer Löcher haben
sie ihre Wellenformmodelle verfeinert. Dabei nutzten sie eine Synergie zwischen
numerischen und analytischen Lösungen der Einsteinschen Gleichungen der
Allgemeinen Relativitätstheorie.
Sie kalibrierten analytische Näherungslösungen (die fast augenblicklich
berechnet werden können) mit präzisen numerischen Lösungen (die auch auf
leistungsfähigen Computern sehr lange dauern). Dies ermöglicht es den
AEI-Forschern, die verfügbare Rechenleistung effektiver zu nutzen, schneller zu
suchen, mehr potenzielle Signale verschmelzender Schwarzer Löcher in O2 zu
entdecken und ihre Quellen zu bestimmen.
AEI-Forscher haben auch Simulationen von Verschmelzungen binärer Neutronensterne
und Bosonensterne durchgeführt. Bei diesen können gleichzeitig
elektromagnetische Strahlung und Gravitationswellen beobachtet werden, und sie
können für neue präzise Tests der Einsteinschen Relativitätstheorie genutzt
werden.
|

