|
Die Temperatur der Venusoberfläche
Redaktion / DLR
astronews.com
18. Dezember 2006
Wissenschaftlern ist es gelungen, mit einem Spektrometer an
Bord der ESA-Raumsonde Venus Express unter der undurchsichtigen,
mächtigen Kohlendioxydatmosphäre die Temperaturen auf der Oberfläche der Venus
zu messen. Aus Infrarot-Signalen in bestimmten Wellenlängen konnte die erste
Karte der Temperaturverteilung eines großen Gebiets auf der Südhalbkugel der
Venus erstellt werden.
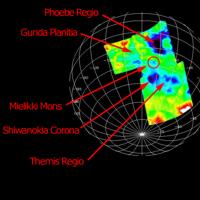
Temperaturkarte eines Gebiets etwa der Größe Afrikas auf der
Südhalbkugel der Venus, das zumindest in geologischer
Vergangenheit von starker vulkanischer Aktivität geprägt wurde.
Die Temperaturen wurden am 10. August 2006 durch
Infrarotmessungen mit dem Experiment VIRTIS an Bord der
Raumsonde Venus Express im Verlauf ihres 112. Orbits ermittelt.
Bild: ESA/VIRTIS VenusX-Team [Gesamtansicht
mit weiteren Erläuterungen]
|
Die Temperaturunterschiede zwischen den Tiefländern und den mehrere Kilometer
hohen Bergmassiven der Venus sind nicht unbeträchtlich: Sie betragen bis zu 30
Grad Celsius. Allerdings liegen die Durchschnittstemperaturen auf der Venus bei
460 Grad Celsius, einer Hitze, die sogar Blei schmelzen lassen würde. "Das
bedeutet einen riesigen Schritt nach vorne in unseren Bemühungen, mit VIRTIS
einzelne Strukturen auf der Venus anhand ihrer Temperatur identifizieren zu
können", erläutert Jörn Helbert vom DLR-Institut für Planetenforschung in
Berlin-Adlershof die Ergebnisse. Der Planetenforscher ist auf der Suche nach
aktiven Vulkanen auf der Venus.
In bestimmten Infrarotwellenlängen, so genannten "atmosphärischen Fenstern",
durchdringt die Wärmeabstrahlung der Venusoberfläche die 100 Kilometer mächtige
Atmosphäre – diese Signale werden von dem Spektrometer VIRTIS auf Venus
Express erfasst. "Die Messungen der Temperaturen mit dem Spektrometer zeigen
eine ausgezeichnete Übereinstimmung mit den Höhenmessungen der amerikanischen
Mission Magellan aus den 90er-Jahren", freut sich Jörn Helbert, der
Mitglied im VIRTIS-Team von Venus Express ist. Die Raumsonde der
Europäischen Weltraumorganisation ESA umrundet den Nachbarplaneten der Erde seit
dem 11. April 2006 (astronews.com berichtete).
Der DLR-Wissenschaftler hat die Forschungsergebnisse vergangene Woche auf einer
Konferenz der American Geophysical Union in San Francisco präsentiert.
"Wir sind total begeistert von diesem Resultat", kommentiert Giuseppe Piccioni
vom Institut für Astrophysik und Kosmophysik in Rom, einer der beiden
VIRTIS-Hauptexperimentatoren, das Ergebnis. "Damit wurde in einem weiteren
wichtigen Punkt auf unserer wissenschaftlichen Aufgabenliste ein bedeutendes
Ergebnis erzielt". Auch Pierre Drossart vom Observatorium Meudon in Paris, der
zweite VIRTIS-Hauptexperimentator, zeigt sich hocherfreut: "Durch die hohe
Übereinstimmung unserer Temperaturkarte mit den topographischen Magellan-Radarmessungen
der Venus können wir sogar Lücken in den Karten schließen, die von dieser
NASA-Mission übrig geblieben sind."
Die Wissenschaftler wenden für ihre Untersuchungen ein eigens entwickeltes
Rechenmodell an, das gewissermaßen Schicht für Schicht die zur Messung der
Oberflächentemperatur störende Atmosphäre aus den komplexen Daten entfernt.
"Inzwischen verstehen wir sehr genau, was wir aus unseren Messungen herauslesen
können", erklärt Jörn Helbert. "Mit diesem Rechenprogramm zur 'Wolkenentfernung'
sind wir in der Lage, die Temperaturen am Boden genau zu messen. Die Ergebnisse
sind ziemlich eindeutig."
Mit der Magellan-Mission wurden Hunderte Vulkane auf der Venus mit
Radardaten identifiziert: Wäre einer davon noch aktiv – was nicht
unwahrscheinlich ist – würde er sich durch bis zu 1.300 Grad heißes Magma anhand
seiner gegenüber der Umgebung stark erhöhten Temperatur verraten, so die Annahme
der Forscher. Im Sonnensystem sind nur die Erde und der Jupitermond Io
vulkanisch aktiv und fördern glühend heiße Lava.
Es ist allerdings extrem schwierig, Informationen über die Verhältnisse auf der
Oberfläche unseres Nachbarplaneten zu bekommen. Die Venus ist permanent von
einer dicken Wolkenhülle umgeben, die in den Wellenlängen, für die das
menschliche Auge empfindlich ist, keinen Blick bis zum Boden des Planeten
gestattet. Obwohl die Venus neben dem Jupiter als hellstes Objekt am Nachthimmel
steht, ist es mit Teleskopen auf der Erde kaum möglich, Informationen über die
Oberfläche des Planeten zu erhalten. Zwar wurden seit 1990 mit erdgestützten
Beobachtungen im nahen Infrarot erste Messungen der Wärmeabstrahlung von der
Oberfläche des Planeten durchgeführt, doch die räumliche Auflösung dieser Daten
war sehr beschränkt.
Erst seit Mitte der 80er-Jahre sind die "spektralen Fenster" bekannt, durch die
in den Wellenlängen des nahen Infrarots von der Oberfläche reflektierte
Sonnenenergie und auch die vom heißen Boden abgegebene Wärmestrahlung wieder
durch die Atmosphäre nach außen dringen können. Die Instrumente, mit denen man
diese Wärmesignale aufzeichnet, nennt man Spektrometer. Nahe der Venus wurden
1990 erstmals von der amerikanischen Raumsonde Galileo, die sich durch
einen engen Vorbeiflug an der Venus für ihre Reise zum Planeten Jupiter
beschleunigte, Spektrometerdaten der Oberfläche in einigen Wellenlängen zwischen
0,8 bis 5,2 Mikrometern (also tausendstel Millimeter) aufgezeichnet. Wegen der
hohen Geschwindigkeit der Sonde wurde aber nur ein kleiner Teil der Venus
erfasst, auch war die Auflösung sehr gering.
Mit dem "M-Kanal" von VIRTIS (Visible and Infrared Thermal Imaging
Spectrometer) soll es Venus Express gelingen, erstmals systematisch
eine bildhafte Wärmekarte der Oberfläche und der oberflächennahen
Atmosphärenschichten zu erstellen. VIRTIS-M nutzt dabei zwei
Wellenlängenbereiche: Zum einen das Spektrum zwischen 0,25 Mikrometern und 1,0
Mikrometern (sichtbares Licht bis nahes Infrarot) und zum anderen zwischen 1,0
Mikrometern und 5,0 Mikrometern (Grenze zum mittleren Infrarot). Der zweite Teil
des Experiments besteht aus dem hochauflösenden Spektroskopiekanal VIRTIS–H zur
punktuellen Erstellung von Infrarotspektren der Venusatmosphäre.
"Für die Temperaturmessungen der Oberfläche nutzen wir von den 120
Spektralkanälen von VIRTIS gerade einmal drei. Aber diese atmosphärischen
Fenster sind die einzige Möglichkeit, etwas über die Oberfläche der Venus zu
lernen", sagt Jörn Helbert. "Wir sind die Ersten, die aus einer Umlaufbahn der
Venus durch diese Fenster blicken", sagt Helbert. VIRTIS wurde ursprünglich beim
DLR in Berlin für die ESA-Kometensonde Rosetta konstruiert, die sich seit
2004 auf dem Weg zum Kometen Churyumov-Gerasimenko befindet, den sie 2014
erreichen wird.
Die Temperaturmessungen der Oberfläche erfolgen in den Wellenlängen 1,02, 1,10
und 1,18 Mikrometern. In diesen spektralen Fenstern dringt die vom Boden der
Venus abgestrahlte Hitze nach außen und kann von VIRTIS aus der Umlaufbahn
aufgezeichnet werden. Die Sonde befand sich zum Zeitpunkt der Messungen am 10.
August 2006 in ihrem 112. Orbit in einer Entfernung von etwa 60.000 Kilometern.
Die Wärmestrahlung ist trotz des Blicks durch die atmosphärischen Fenster immer
noch von Absorptions- und Streueffekten in den Wolken- und Dunstschichten
beeinflusst. Aus diesem Grund wendet Jörn Helbert eine Art "Wolkenschieber" an,
eine Rechenprozedur, mit der diese störenden Effekte beseitigt werden und am
Ende unverfälschte Temperaturangaben gemacht werden können.
Es gibt auf der Venus zwischen Tag und Nacht keine Temperaturunterschiede. Die
Hitze ist global unter der hundert Kilometer hohen Kohlendioxydatmosphäre
gefangen und kann nicht nach oben ins Weltall entweichen. Variationen in den
Temperaturen ergeben sich, wie auf der Erde, aus der unterschiedlichen Höhenlage
von Bergen – dort ist es mit 447 Grad Celsius etwas "kälter" – oder Tiefebenen,
wo es 20 bis 30 Grad Celsius wärmer ist. Verantwortlich für die insgesamt extrem
hohen Temperaturen von um die 460 Grad Celsius ist ein massiver Treibhauseffekt,
dessen Wirkungsweise noch nicht in allen Einzelheiten verstanden ist. Der
Luftdruck am Boden ist etwa 90 Mal höher als auf der Erde.
Mithilfe der topographischen Karten der Magellan-Mission ist die
Landschaft der Venus sehr detailreich vermessen worden, doch verblieben einige
Lücken, in denen keine Daten vorliegen. Beim VIRTIS-Experiment werden diese
Höhenangaben in einem ersten Schritt zur Vorhersage der erwarteten Temperaturen
herangezogen: Dabei zeigen die VIRTIS-Daten einen hohen Grad an Übereinstimmung
mit der Vorhersage. Darüber hinaus lassen sich kleinräumige, regionale
Temperaturunterschiede feststellen. In einem nächsten Schritt werden die
VIRTIS-Ergebnisse auf Anomalien untersucht, die beispielsweise auf besonders
heiße Stellen hindeuten – so genannte "Hot Spots", die einen möglicherweise
aktiven Vulkan verraten würden. Umgekehrt kann mit den VIRTIS-Temperaturdaten
auf die Topographie geschlossen werden und so die letzten Lücken der
topographischen Magellan-Radarkarten geschlossen werden.
Themis Regio, Gunda Planitia und Phoebe Regio, die von VIRTIS-M abgebildeten
Gebiete, befinden sich auf der Südhalbkugel der Venus bei etwa 270 Grad
östlicher Länge und 35 bis 40 Grad südlicher Breite. Themis Regio ist ein
Hochplateau, das – zumindest in der geologischen Vergangenheit – von starker
vulkanischer Aktivität geprägt wurde. Über mehrere hundert Kilometer ziehen sich
miteinander verbundene, so genannte "Coronae" durch das Hochland: Längliche oder
kreissegmentförmige Bergrücken, die um ein gemeinsames Zentrum angeordnet sind,
das sich möglicherweise über einem vulkanischen "Hot Spot" im Mantel oder der
Kruste des Planeten gebildet hat. Aus den Radarbildern der Magellan-Mission
sind zahlreiche Vulkane und Grabenbrüche in den Coronae von Themis Regio zu
erkennen, die wie in einer Kette von Nordwesten nach Südosten aufgereiht sind.
Diese Vulkanzone heißt Parga Chasma und verbindet Themis mit Atla Regio.
Phoebe Regio ist eine so genannte "Tessera", ein Gebiet, in dem die Oberfläche
mosaikartig zergliedert ist. In Phoebe Regio landeten die meisten robotischen
Venera-Landekapseln der Sowjetunion. Neben den großflächigen Hochplateaus
sind auch einzelne Vulkanstrukturen zu erkennen, wie etwa Mielikki Mons. Im
Südosten der gezeigten Karte befindet sich ein Gebiet, von dem Magellan keine
topographischen Daten liefern konnte, die nun aber über den "Umweg" der
Temperaturmessungen modelliert werden können. Durch die Integration von
Messdaten aus möglichst vielen Venus Express-Orbits wird es im weiteren
Verlauf der Mission mit VIRTIS gelingen, mit Daten in verbesserter räumlicher
Auflösung nicht nur auf der südlichen Hemisphäre eine qualitativ bessere
Darstellung der Venustopographie zu bekommen.
 |
|

