Mit dem Bau eines neuen Großteleskops wollen Amerikaner und Europäer den
Ursprung des Universums gründlicher denn je erforschen. Dazu soll in der chilenischen
Atacama-Wüste ein Netzwerk von 64 Antennen entstehen, die den Himmel im
Millimeterwellenbereich untersuchen. Projektierte Fertigstellung: 2009.
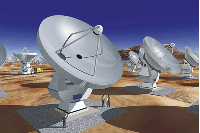
So stellt sich die ESO das neue Riesenteleskop in Chile vor. Foto ESO |
Bisher gibt es noch keinen hektischen Wissenschaftsbetrieb auf dem in 5000 Meter Höhe
gelegenen Hochplateau der Atacama-Wüste. Doch wenn es nach den Verantwortlichen der
amerikanischen Wissenschaftsstiftung (NSF), der Europäischen Südsternwarte (ESO), der
Max-Planck-Gesellschaft und weiterer europäischer Institute geht, könnte hier bald das
höchstgelegene ständig betriebene Observatorium der Welt entstehen. Am 10. Juni wurden
zumindest die Verträge über die erste Projektphase unterzeichnet.
Das projektierte Teleskop namens ALMA (für "Atacama Large Millimeter Array")
soll das Universum im Millimeterwellenbereich in bisher unerreichter Schärfe abbilden.
"Das Projekt", so Dr. Robert Eisenstein, Direktor für Mathematik und Physik bei
der NSF, "ist eine bahnbrechende internationale Partnerschaft, die der astronomischen
Beobachtung weitreichende Möglichkeiten eröffnet. Mit diesem Teleskop sind Astronomen in
der Lage, die Entstehung von Sternen und Planeten im Detail zu erforschen und besser zu
verstehen, wie sich die ersten Galaxien im sehr frühen Universum gebildet haben."
Auch der ESO-Generaldirektor Riccardo Giacconi zeigte sich absolut begeistert und
zählt die geplante Anlage schon jetzt zu den wichtigsten bodengestützten Observatorien
des 21. Jahrhunderts: "Es wird Schlüsselbereiche des elektromagnetischen Spektrums
für die Erforschung des sehr frühen Universums sowie der interstellaren Wolken, in denen
Sterne und Planeten entstehen, erschließen."
Bei ALMA handelt es sich nicht nur um ein Teleskop, sondern um ein Netzwerk oder Array
von insgesamt 64 Antennen, die jeweils einen Durchmesser von zwölf Meter haben werden und
je nach Bedarf auf einer Fläche von zehn Kilometer Durchmesser verteilt werden können.
Alle Antennen können gleichzeitig ein Objekt anvisieren und so astronomische Bilder von
außergewöhnlicher Schärfe gewinnen.
In der jetzt beschlossenen Projektphase sollen erst einmal zwei Prototypen der Antennen
entwickelt und gebaut werden. Dafür stellen die USA 26 Millionen Dollar und Europa 15
Millionen Euro zur Verfügung. Auf die endgültige Genehmigung des Projektes hoffen die
Beteiligten bis Anfang 2001. 2005 könnte dann erste Antennen in Betrieb gehen, endgültig
fertig dürfte ALMA nicht vor 2009 sein. Auch die Japaner, die bisher ein ähnliches
Projekt planten, wollen sich mittlerweile ALMA anschließen. Chile und andere Länder
haben ähnliches Interesse bekundet. Dies würde ALMA zu einem einmaligen internationalen
Großprojekt machen.
ALMA wäre die ideale Ergänzung für andere Groß-Teleskope wie dem ESO Very Large
Telescope (VLT) oder dem Hubble-Weltraumteleskop. Und durch seine besonderen Aufbau kann
es mit diesen Teleskopen auch ohne weiteres mithalten: Werden nämlich die Signale der bis
zu zehn Kilometer auseinanderliegenden Einzelantennen in einem Zentralrechner verbunden,
erreicht man die gleiche Auflösung wie ein Einzelteleskop von zehn Kilometer Durchmesser.
Und die ist beachtlich: Man könnte damit noch einen Pfennig in 200 Kilometer Entfernung
auflösen.
Links im WWW:
- ALMA, Projektseite der ESO

